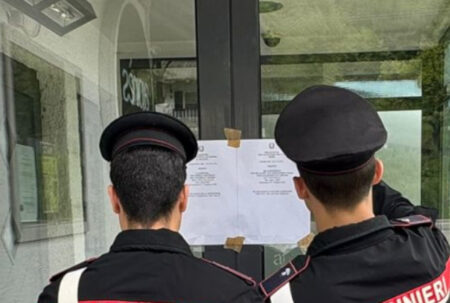Florian Stumfall
Über Werte, Demokratie und die unrühmliche Rolle der USA

Nun lehrt aber die Erfahrung, dass diese meist nicht näher bezeichneten Werte just in einer solchen Gesellschaft beschworen werden, welche die ihrigen bereits verloren hat. Es ist wie mit dem Atmen. Ein Asthmatiker redet darüber, ein gesunder Mensch nicht. Vor, sagen wir, fünfzig Jahren, als der redliche Kaufmann, der treue Gatte, der unbestechliche Beamte, der ehrliche Politiker die Norm bestimmten, war von Werten nie die Rede. Es gab Dinge, die waren selbstverständlich, und andere, die tat man nicht. Dieses „das tut man nicht“ wurde anno 1968 ff abgeschafft. Einige Zeit darauf schlich sich die Wert-Floskel ein.
Demokratie ist kein Wert
In den Fällen aber, in denen die Benennung eines Wertes geschieht, wird, jedenfalls im politischen Zusammenhang, meist die Demokratie genannt, leider ein untaugliches Beispiel. Denn die Demokratie ist ein Ordnungsprinzip, kein Selbstzweck mit ethischer Grundlage. Wertbezogen ist an ihr, was sie ermöglichen und organisieren soll, nämlich die Freiheit im Staate. Die Freiheit ist ein Wert an sich, so wie die Gerechtigkeit oder die Hilfsbereitschaft. Wäre die Demokratie ein Wert an sich, so müsste sie auch im Operationssaal, auf einem Segelschiff oder im Orchester Anwendung finden.
In zahlreichen Kulturen der Welt organisieren die Menschen ihr Zusammenleben auf andere Weise, als es im Westen geschieht, und die Demokratie ist dabei oftmals als Ordnungsprinzip überflüssig. Bei anderen geschichtlichen Voraussetzungen, Traditionen und Zielvorstellungen können andere Regelwerke das Ziel der Gesellschaft, nämlich das größte Glück der größten Zahl zu organisieren, gegebenenfalls besser erreichen als es durch importierte Ordnungs-Muster möglich wäre.
Der Export von Demokratie
Diese Einsicht sollte, empirisch belegt und kontrollierbar an tausend Beispielen, kein Geheimnis sein, doch oftmals widersetzt sich die Politik der Beweiskraft der Wirklichkeit. Nimmt man die Strategie der NATO, mit oder ohne EU, als Exempel, so ist festzustellen, dass sie sich absolut gegenläufig verhält. Der Export von Demokratie, das heißt, kriegerische Überfälle auf andere Länder unter dem Hinweis und mit der Erklärung, dort fehle es an Demokratie, gehört zu den typischen Verhaltensmustern des Bündnisses und in der Hauptsache natürlich der USA.
Sie erheben den Anspruch, die Berufung auf die Werte rechtfertige diese Politik, wobei sie diese Werte als global gültig ausgeben. Dabei aber handelt es sich um einen Anspruch postkolonialer Bevormundung. Samuel Huntington schrieb in seinem vorzüglichen Buch „Der Kampf der Kulturen“ – von Eine-Welt-Fanatikern wütend bekämpft – über das tatsächliche Gewicht westlicher Theoreme: „Die Nichtwestler betrachten als westlich, was der Westen als universal betrachtet.“ Und die Nichtwestler sind in der Überzahl, wenn man sich schon auf die Demokratie beruft, der das Mehrheitsprinzip innewohnt.
Menschenrechte quo vadis?
In diesem Zusammenhang ist natürlich sehr schnell von den Menschenrechten die Rede. Sie stellen zwar tatsächlich eine ethische Größe dar, aber eben nur im westlichen Sinn, folgend einer durch das Christentum geprägten Sicht vom Menschen und bestätigt durch die Aufklärung. Auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN kann daran nichts ändern, wie die moslemischen Länder zeigen. Sie haben die Menschenrechte unter den Vorbehalt des Islam gestellt, das heißt, sie gelten nur insoweit, als sie dem Wort des Propheten nicht zuwiderlaufen. Hier ist es zu sehen: andere geschichtliche Voraussetzungen, Traditionen und Zielvorstellungen führen zu abweichenden Ergebnissen.
Das aber hindert die Führungsmacht des Westens nicht daran, den Anspruch auf Demokratie als ethische Grundlage für Infiltration, Umsturz und Krieg zu nehmen, wo immer es strategisch vorteilhaft erscheint. Dies ist Anlass genug, einen Blick auf die demokratische Qualität der USA selbst zu werfen.
Demokratie in Amerika
Tatsache ist, dass in den USA niemand Kandidat für das Amt des Präsidenten werden kann, der nicht mindestens eine Milliarde Dollar aufwenden kann, für Senatoren und Gouverneure gilt das mit entsprechenden Prozenten Abschlag. Vor der Wahl, die sie gegen Trump verlor, hatte Hillary Clinton erklärt, sie versuche, für ihre Kampagne zwei Milliarden US Dollar zu sammeln.
Eine solche Kandidatensuche widerspricht dem demokratischen Prinzip der Gleichheit, weil nur Super-Reiche daran teilnehmen können. Oder aber ein von diesen ausgewählter Kandidat – Beispiel Obama – wird von ihnen mit den nötigen Mitteln ausgestattet und verbleibt somit sein Lebtag in der Abhängigkeit von seinen Gönnern. Auch das widerspricht demokratischen Regeln. Die USA sind keine Demokratie, sie sind eine klassische Plutokratie, das heißt, es gibt die Herrschaft nicht des Volkes, sondern einiger sehr reicher Menschen und Clans. Arend Oetker, von 2000 bis 2005 Vorstands-Vorsitzender der Atlantik-Brücke, einer US-gelenkten Propaganda- Organisation, die der frühere Weltbank-Präsident McCloy und der Großbankier Eric Warburg gegründet haben, und die den Einfluss der USA in Deutschland fördert, hat von ihrer Bedeutung gesagt: „Die USA werden von 200 Familien regiert und zu denen wollen wir gute Kontakte haben.“ Seither dürfte die Zahl der Familien geringer und ihr Vermögen größer geworden sein.
Wenn es schon mit der demokratischen Qualität der USA schlecht bestellt ist, dann, so hofft man, dürfte doch wenigstens ihre Rolle als Statthalter der Menschenrechte, die sie über den ganzen Kalten Krieg gespielt haben, außer Zweifel stehen. Doch auch hier gibt es Überraschungen. Denn am 26. Oktober, kaum zwei Monate nach dem 11. September, wurde der Patriot Act erlassen, der die wesentlichen Bürgerrechte außer Kraft setzt. Die ungewöhnlich kurze Zeit der Rechtssetzung lässt es so ausschauen, als habe das Weiße Haus nur auf die Gelegenheit gewartet, die Vorlagen aus der Schublade zu nehmen und durch den Kongress zu peitschen, was angesichts der damaligen Stimmung nicht schwer war.
Billige Ausrede
Das Gesetz schafft mehr oder minder vollständig das Fernmeldegeheimnis und den Schutz der Privatsphäre ab, Hausdurchsuchungen sind erlaubt, auch ohne Wissen des Betroffenen, das Bankgeheimnis ist abgeschafft, und jedermann kann auf Verdacht für unbestimmte Zeit in Haft genommen werden, ohne das Recht auf einen Anwalt. Mit diesem Standard der Menschenrechte dürften die USA weit hinter manchem Land liegen, das sie einer undemokratischen Ordnung oder der Verfehlungen gegen die Menschenrechte zeihen oder aus solchen Gründen schon überfallen haben.
Wenn sich die westliche Allianz schon nicht aus Respekt vor anderen Kulturen davon abhalten lässt, ihren Frieden zu stören, so sollte sie sich angesichts des einschlägigen Zustandes ihrer Führungsmacht für ihren nächsten Krieg – sei es in Venezuela oder anderswo – eine bessere Ausrede zurechtlegen als diejenige des Demokratie-Exportes.
Kolumne von Dr. Florian Stumfall
Erstveröffentlichung PAZ (redaktion@preussische-allgemeine.de)