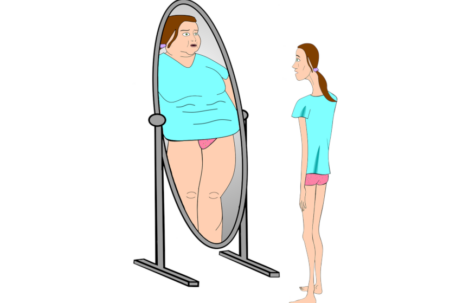Vom Burnout zum Silicon Valley: Österreicher schafft es zu OpenAI

Es ist eine Geschichte, die klingt wie aus einem Film. Peter Steinberger ist 40 Jahre alt, aus Wien und baute an einem Wochenende im November einen Prototyp. Drei Monate später arbeitet er für OpenAI, der Firma hinter ChatGPT.
Der erste Erfolg
Steinberger ist in der österreichischen Startup-Szene kein Unbekannter. 2011 gründete er in Wien die Firma PSPDFKit. Was das Unternehmen macht, klingt erst mal nicht besonders spektakulär: Eine Software, mit der man PDF-Dateien auf Handys und Tablets anzeigen und bearbeiten kann. „Ich weiß, eine PDF-Software klingt nicht cool“, sagte Steinberger damals selbst. Aber die Software war so gut, dass sie bald überall eingesetzt wurde. Wenn Sie bei Dropbox ein Dokument am Handy öffnen – das ist PSPDFKit. Auch Apple, IBM, SAP und die Lufthansa nutzten die Technologie des Wieners. Bis zu einer Milliarde Menschen weltweit nutzten Apps, in denen Steinbergers Code lief. Das Besondere: Steinberger nahm über zehn Jahre lang kein Geld von Investoren. Die Firma wuchs aus eigener Kraft und 2021 kam dann der große Tag: Der Investor Insight Partners kaufte sich für 100 Millionen Euro ein. Steinberger verkaufte seine Anteile und zog sich zurück.
Das Loch nach dem Erfolg
Doch dann kam der Absturz. „Ich hatte mich kaputt gearbeitet“, schrieb Steinberger später in einem sehr persönlichen Blogeintrag. 13 Jahre lang hatte er fast jedes Wochenende gearbeitet. Jedes Problem, das niemand anders lösen konnte, landete bei ihm. Nach dem Verkauf fiel er in ein tiefes Loch. Drei Jahre lang passierte wenig. Steinberger investierte als Business Angel in andere Startups, aber unternehmerisch war es ruhig um ihn. Bis 2024, als er anfing mit künstlicher Intelligenz zu experimentieren.
Im November 2025 hatte Steinberger eine Idee: Was, wenn man eine KI nicht nur zum Chatten nutzt, sondern sie wirklich Dinge erledigen lässt? An einem Wochenende programmierte er einen Prototyp. Die Idee war einfach: Man schreibt der KI über WhatsApp oder Telegram und sie erledigt Aufgaben am Computer. Dazu gehören zum Beispiel: E-Mails beantworten, Kalender verwalten, Dateien erstellen oder sogar Code schreiben. Er nannte das Projekt „Clawdbot“, ein Wortspiel auf „Claude“, eine andere bekannte KI.
Am 25. November veröffentlichte er dann den Code auf GitHub, einer Plattform für Programmierer. Was dann passierte, hatte niemand erwartet. Innerhalb weniger Wochen wurde Clawdbot zum am schnellsten wachsenden Projekt in der Geschichte von GitHub. Über 200.000 Menschen markierten es als Favorit. Medien auf der ganzen Welt berichteten. Tech-Größen wie Elon Musk sprachen von den 2frühen Stadien der Singularität“.
Der Namensstreit
Doch dann kam der Dämpfer. Anthropic, die Firma hinter der KI „Claude“, drohte mit einer Klage. Der Name „Clawdbot“ sei zu ähnlich. Steinberger musste zu „Moltbot“ umbenennen, weil Hummer sich häuten, wenn sie wachsen. Schlimmer noch: In den zehn Sekunden, in denen sein alter GitHub-Name frei war, kaperten Betrüger den Account. Sie erfanden eine Kryptowährung und behaupteten, sie stamme von Steinberger. Zeitweise war das Fake-Projekt 16 Millionen Dollar wert. „Ich war nah dran zu weinen“, sagte Steinberger später. „Alles war im Arsch.“ Er dachte daran das ganze Projekt zu löschen aber er machte weiter. Ende Januar folgte eine weitere Umbenennung zu „OpenClaw“, dem Namen, der bis heute gilt.
Was OpenClaw so besonders macht
OpenClaw ist kein normaler Chatbot wie ChatGPT. Der entscheidende Unterschied ist, dass es auf dem eigenen Computer läuft und dort wirklich Dinge tun kann. Man schreibt der KI über WhatsApp zum Beispiel „Sortiere meine E-Mails von heute“ und sie macht es. Oder: „Schreibe ein Python-Programm, das meine Fotos nach Datum sortiert“ und die KI programmiert es, testet es und führt es aus. Die Software läuft rund um die Uhr im Hintergrund. Sie merkt sich, was man ihr aufträgt, lernt die Arbeitsweise des Nutzers kennen und wird mit der Zeit immer besser. Anders als bei ChatGPT bleiben alle Daten auf dem eigenen Rechner und nichts wird in eine Cloud hochgeladen. Das macht OpenClaw mächtig, aber auch gefährlich, denn die Software hat vollen Zugriff auf den Computer. IT-Sicherheitsexperten warnen vor den Risiken, wenn so viel Kontrolle einer KI überlassen wird.
Der Wettkampf der Tech-Giganten
Plötzlich wollten alle Tech-Konzerne Steinberger haben. Microsoft-Chef Satya Nadella rief Steinberger persönlich an. Auch Meta und Anthropic warben um ihn. Am Ende entschied sich Steinberger für OpenAI. Am vergangenen Sonntag, den 15. Februar, verkündeten sowohl er als auch OpenAI-Chef Sam Altman den Deal. Steinberger soll dort an der „nächsten Generation persönlicher Agenten“ arbeiten. KI-Assistenten, die nicht nur antworten, sondern wirklich handeln. „Ich hätte aus OpenClaw ein riesiges Unternehmen machen können“, schrieb Steinberger in seinem Blog. „Aber das reizt mich nicht. Ich will die Welt verändern, nicht eine große Firma aufbauen.“
Eine Bedingung hatte Steinberger aber: OpenClaw muss Open Source bleiben. Das bedeutet, dass jeder den Code weiterhin kostenlos nutzen und verändern kann und OpenAI stimmte zu. Das Projekt wird in eine unabhängige Stiftung überführt, die OpenAI finanziell unterstützt. „Die Zukunft wird extrem multi-agentisch sein“, sagte Altman. „Es ist uns wichtig, Open Source als Teil davon zu unterstützen.“
Von Wien ins Silicon Valley
Für die österreichische Tech-Szene ist Steinbergers Erfolg bitter-süß. Einerseits zeigt er, dass man auch aus Wien heraus Weltklasse-Produkte bauen kann und andererseits geht ein weiteres Talent nach Amerika verloren. „Europa hat mir keine andere Wahl gelassen“, sagte Steinberger sinngemäß in Interviews. Die Rahmenbedingungen in Europa sind komplizierte Regulierungen, Mangel an Risikokapital und bürokratische Hürden. Das Alles macht es fast unmöglich, hier ein großes KI-Unternehmen aufzubauen.
Steinberger wird in den USA arbeiten, wahrscheinlich in San Francisco, wo OpenAI seinen Sitz hat. Dort wird er mit hunderten Ingenieuren an der Zukunft der künstlichen Intelligenz arbeiten. Sein Ziel: einen KI-Assistenten bauen, „den sogar meine Mutter nutzen kann“.